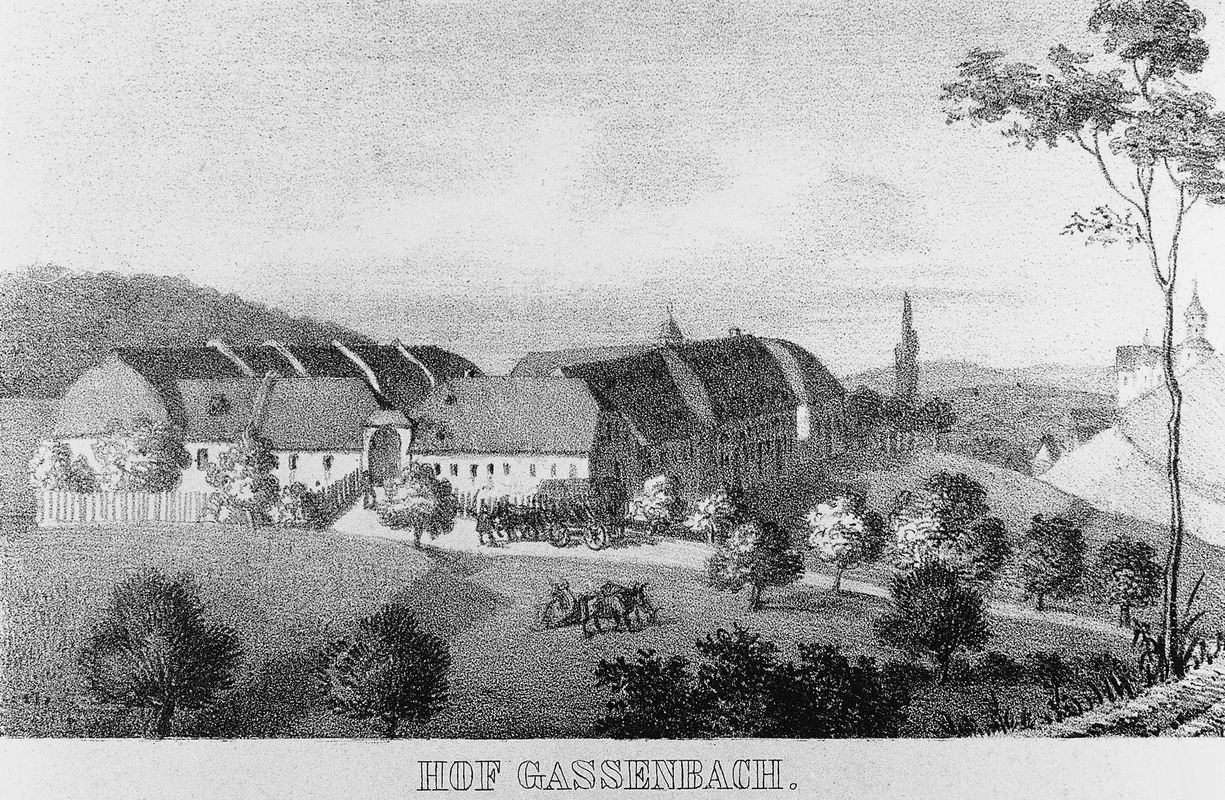Abwägungsgedanken zu Klimaschutz und Solarpark

Abwägungsgedanken zu Klimaschutz und Solarpark
Der erstbeste Weg muss nicht der beste sein
Die Thematik „Solarpark“ bzw. Photovoltaikfreiflächenanlage ist nun auch in Idstein angekommen. Spätestens mit dem vom 28. Januar 2020 datierten Brief an den Magistrat, in dem das Unternehmen Trianel beantragt, die Stadt Idstein möge das Bauleitplanverfahren anstoßen, um einen sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan für knapp 80.000qm landwirtschaftlicher Fläche auf dem Rosenkippel aufzustellen.
Mit diesem Antrag wurde dem Magistrat praktischerweise gleich die Beschlußvorlage mitgeliefert, die in die hiesigen entscheidenden Gremien übernommen wurde. Die den Gesellschaftern der Trianel gehören vorrangig die Stadtwerke solcher Städte wie Bochum, Aachen oder Heidelberg – den dortigen Beschäftigten ist mithin sehr geläufig, wie man entsprechende Beschlußvorlagen schreibt.
Mit dem Aufstellungsbeschluß will die Trianel dann an einer Ausschreibung der Bundesnetzagentur teilnehmen, die darüber entscheidet, welche Vorhaben nach dem Erneuerbare Energien Gesetz 2017 (EEG) gefördert werden. Konkret bedeutet dies, dass der voraussichtige Gewinn des Unternehmens u.a. mit davon abhängig ist, ob und in welcher Höhe eine Förderung nach EEG zu erwarten ist.
Und genau hier liegt der politische Hase im Pfeffer:
Zum einen wird natürlich zunächst grundsätzlich zu debattieren sein, ob – und ob an der vorgesehenen Stelle auf dem Rosenkippel, der aktuell landwirtschaftlich zum Getreideanbau genutzt wird – ein Solarpark errichtet werden kann und sollte.
Zum anderen aber gibt es einen wichtigen Aspekt, der über die Faktoren der reinen Machbarkeit der hier debattierten Form der Energiegewinnung und ihrer baulichen Notwendigkeiten weit hinausgeht:
Es muß die grundsätzliche politische Frage gestellt und erörtert werden, ob die Idsteiner Flächen am Rosenkippel (oder, womöglich, andere und/oder weitere Flächen) bei entsprechender Eignung nach technischen, boden-, natur- und klimaschutzrelevanten Aspekten tatsächlich zugunsten Dritter aus der landwirtschaftlichen Nutzung genommen werden sollten.
Anders gefragt:
Was haben die Stadt Idstein und ihre Bewohner:innen davon, einem privat wirtschaftenden Unternehmen wie der Trianel (und damit anderen Kommunen, allen voran den zwei Hauptanteilseignern Stadtwerke Bochum und Stadtwerke Aachen) die Teilnahme an einer Ausschreibung zur Förderfähigkeit ihrer wirtschaftlichen Interessen zu ermöglichen?
„Das Kerngeschäft der Trianel GmbH sind die ganzheitliche und digitale Energiebeschaffung, Lieferung und Vermarktung von Energie und das Management von Energieportfolios. Trianel beschafft an den Großhandelsmärkten Energie für Weiterverteiler und Stadtwerke, um die Belieferung ihrer Endkunden mit Energie sicherzustellen. Über den Trianel Trading Floor haben Gesellschafter und Kunden Zugang zum internationalen Handelsgeschäft.“ Quelle: Trianel GmbH
Bereits 1939 wurde auf dem Campus des Massachusetts Institute of Technology (MIT) der erste Hausprototyp (Solar 1) errichtet, das ausschließlich durch Sonnenenergie geheizt wurde.
1948 nahm die us-amerikanische Architektin Eleanor Raymond (1887-1989), den Bau des ersten sonnenbeheizten Hauses in Angriff. Das Dover Sun House, wie es genannt wurde, konstruierte sie in Zusammenarbeit mit Dr. Maria Telkes (1900-1995), einer Chemikerin. Diese hatte sich bereits ausführlich und sehr erfolgreich mit der Nutzung der Solarenergie befasst. Das Dover Sun House war das erste Haus, bei dem ein passives Solarenergiekonzept verwirklicht wurde. Für die Wärmeerzeugung werden keinerlei „aktive“ photovoltaische Elemente benötigt, die Elektrizität erzeugen.

Dr. Maria Telkes (li) und Eleanor Raymond (re) 1948 vor dem Dover Sun House
Warum nicht, alternativ, darüber nachdenken und ggf. mit der Trianel verhandeln, welchen wirtschaftlichen Gegenwert die Kommune Idstein und/oder ihre Bürger:innen dabei erhielten?
Noch weiter gedacht:
Warum sollten Idsteiner:innen für einen Solarpark geeignete Flächen nicht vollständig für Idsteiner Belange nutzen, etwa über die Errichtung und den Betrieb einer solchen Anlage in Form einer Idsteiner Energiegenossenschaft unter Beteiligung Idsteiner Bürger:innen . Nicht nur könnten Idsteiner:innen den hier erzeugten Strom zu entsprechenden Konditionen erwerben und eine mögliche Rendite abschöpfen; sondern der von allen unabhängigen Fachleuten und Zukunftsforschern aufgezeigte Weg der Zukunft, weg von großen zentralen Stromanbietern zu kleinen lokalen und regionalen Energieerzeugungsgesellschaften und –genossenschaften, würde in Idstein beschritten werden.

Dr. Maria Telkes, 1956

Eleanor Raymond, 1980
Auch der Flächenbedarf einer für Idsteiner Bedarfe ausgelegten energiegenossenschaftlichen Photovoltaikfreiflächenanlage wäre, im Zweifelsfalle, deutlich geringer und die Klimaschutzbilanz (unter kumulativer Berücksichtigung auch der Boden-, Natur- und Umweltschutzbelange) eine deutlich positivere. Vor allem dann, wenn man nicht über konventionelle Freiflächen-Module nachdenkt, sondern sich mit Agri-PV (d.h. senkrecht installierten, bifacialen Modulen) befaßt, in einer ernsthaften Abwägung.
Klimaschutz ist ein hochkomplexes Thema aufgrund der Vielzahl und Vielfalt der zu berücksichtigenden Parameter. Je mehr Mitspieler, zumal solche mit privatwirtschaftlichen Idstein-fremden Interessen, mitreden wollen, desto schwerer wird es werden, die für Idstein beste Lösung mit der insgesamt besten Klimaschutzbilanz zu erarbeiten.
Die ULI appelliert daher an die Mandatsträger:innen, außer dem von Dritten an Idstein herangetragenen Weg auch alle anderen gangbaren Konstrukte sorgfältig zu prüfen und im Sinne einer zukunftsfähigen Lösung für Idstein zu entscheiden.
Grundsätzlich sind etliche Faktoren der komplexen Gemengelage zu berücksichtigen, die eine mögliche Errichtung einer Photovoltaikfreiflächenanlage von erheblicher Größe darstellt. Sie berühren etliche große Themenkomplexen und müssen mit Sensibilität wie Sach- und Fachkompetenz analysiert und abgewogen werden, um sie zu einem harmonischen, stimmigen und zukunftsfähigen Ganzen in Einklang zu bringen, wie es vor allem mit den noch relativ neuen Möglichkeiten der Agri-PV versucht wird; u.a.:
- Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien am Energiemix
- Dezentrale vs. zentrale Energieproduktion
- Schutzgut Boden
- Verlust von wertvollen Agrarflächen zur lokalen Nahrungsmittelproduktion
- Einflüsse auf das Landschaftsbild
- Nachbarschaftliche Verträglichkeit (Blendwirkung der Bewohner:innen in Idstein-Kern, Lärmentwicklung durch Schallverstärkung)
- Verkehrssicherheitsaspekte (Blendwirkung der Fahrzeugführer auf A3 und ICE-Trasse)
- Möglichkeiten der extensiven, ökologisch sinnvollen Grünlandbewirtschaftung im betreffenden Areal (frühzeitige Ausdeutung möglicher Weidetierhalter etc.)