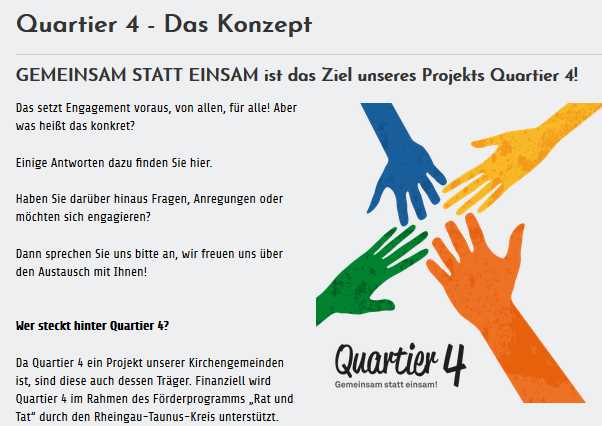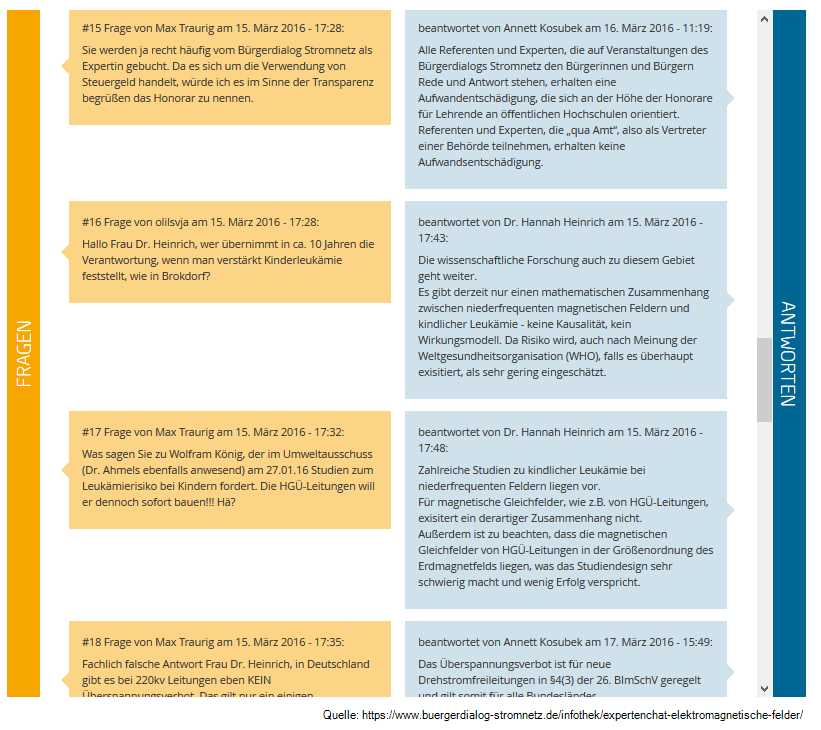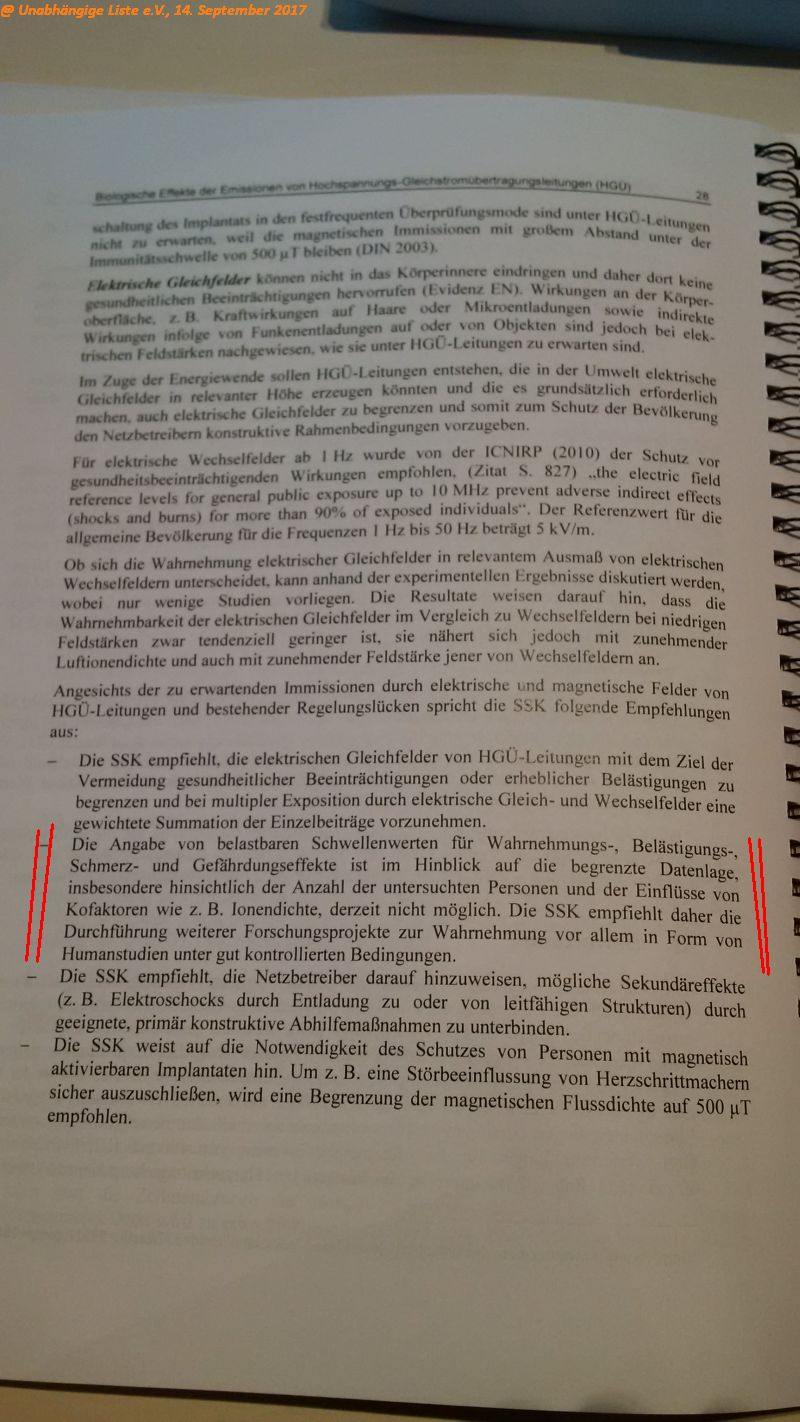Auf ein Wort… Frau Sachse-Domschke und Herr Pfarrer Eisele (Teil 1)
Identifikation mit dem eigenen Quartier, dem Straßenzug oder dem Dorf, in dem man wohnt, beginnt damit, die reine Konsumentenhaltung aufzugeben und an ihre Stelle ein aktives „Ja“ zu eigener Teilhabe zu setzen – diese Überzeugung zur Gestaltung von Dorf- und Quartierszukunft treibt nicht nur die ULI an, sondern auch unsere heutigen Gesprächspartner mit kirchlichem Hintergrund, Karla Sachse-Domschke und Pfarrer Markus Eisele, die Initiatoren von Quartier 4.
ULI: Quartier 4 hat sich auf die Fahnen geschrieben, gerade im dörflichen Raum die Herausforderungen und Aufgaben, vor die die demografische Entwicklung uns alle stellt, aktiv zu adressieren. So will Quartier 4 eine trag- und zukunftsfähige Basis für ein möglichst gutes Lebensumfeld für möglichst viele schaffen und sein.
Frau Sachse-Domschke, Herr Pfarrer Eisele, was macht ein solches gutes Lebensumfeld für Sie aus und welche Eckpfeiler kann Quartier 4 dabei errichten oder stärken helfen?
Sachse-Domschke: Der ländliche Lebensraum, in dem ich groß geworden bin, hat mich geprägt. Als mein Weg mich beruflich nach Frankfurt führte, habe ich viele positive Erfahrungen dorthin mitgenommen. Und das Stadtleben mit seinem großen Angebot an Kultur, Sport und anderen Freizeitaktivitäten begeisterten mich.
Doch was fehlte, war den Kontakt zu Menschen in meinem direkten Wohnumfeld. Weil ich es aber schätze, meine Nachbarn zu kennen, mich mit ihnen auszutauschen und zu erleben, wie man sich gegenseitig nachbarschaftlich ‚unter die Arme zu greift‘, zog es meine kleinen Familie nach der Geburt unseres ersten Kindes zurück auf’s Dorf.
Hier, in Wörsdorf, sind meine Dorf-Nachbarn ein wichtiger Teil meines sozialen Netzes, auch wenn sie nicht direkt nebenan wohnen. Über Kindergarten, Schule, Kirche, Musik- und Turnverein komme ich mit Menschen aller Altersgruppen in Kontakt und erlebe im gemeinsamen Engagement unsere Dorfgemeinschaft. Zusammen mit der dörflichen Nähe zur Natur macht das das gute Lebensumfeld aus, das ich für Menschen jeden Alters erhalten möchte!
Pfarrer Eisele: Nachbarschaft ist ein gutes Stichwort. In einer Zeit, in der wir immer weniger Nachbarn zu brauchen scheinen, weil „man“ in bestimmten Lebensphasen autark ohne nachbarschaftliche Unterstützung leben kann, ist es wichtig, die besondere Qualität von guter Nachbarschaft in Erinnerung zu rufen. Heute können wir online einkaufen, sind mobil, arbeiten nicht mehr vor Ort, haben unsere Freunde andernorts und verbringen unsere Freizeit individuell. Was bleibt da noch an Bedürfnissen, die im Dorf oder im Quartier erfüllt werden müssten? Gerade für die, die nicht aus dem Ort sind, erschließt sich das immer weniger.
Die Megatrends unserer Zeit führen zu Segregation und in letzter Konsequenz zu Vereinzelung. Gerade in diesen Tagen hat der Präsident der Diakonie Deutschland ein gesellschaftliches Bündnis aus Politik und gesellschaftlichen Gruppen, wie Kirchen, Wohlfahrtsverbänden, Sportvereinen und kulturellen Einrichtungen zur Bekämpfung der Einsamkeit angeregt. Der SPD-Politiker Lauterbach sagt dazu: „Die Einsamkeit in der Lebensphase über 60 erhöht die Sterblichkeit so sehr wie starkes Rauchen.“
Dass das Miteinander der Generationen und das freundschaftliche Zusammen- leben Freude bereitet und Spaß macht, erleben ja viele in unseren Dörfern. Ohne aktiven Einsatz droht diese ganz natürliche Art der Begegnung zu erodieren.
Dieser Erosion will Quartier 4 entgegenwirken.
Pfarrer Markus Eisele
Essentiell ist für mich eine Verbesserung der Kommunikation und die Vernetzung untereinander.
Es gibt schon viele gute Ideen und Projekte, bei denen Menschen sich für andere, für ein Gemeinwohl, einsetzen oder einsetzen wollen. Wenn sie sich aber als ‚Einzelkämpfer‘ wahrnehmen müssen und nicht die besten Erfolgs- chancen sehen, führt das zu Frustration und „Ach, ich kann sowieso nichts bewirken“-Pessimismus.
Karla Sachse-Domschke
ULI: Auch die ULI hat sich ja Bürgerengagement und Teilhabe auf die Fahnen geschrieben, wenn auch im kommunalpolitischen Kontext. Wobei „Politik“ zunächst einmal von „polis“, also dem „Gemeinwesen“ herzuleiten ist. Damit sind der soziopolitische Ansatz der ULI und die kirchengemeindliche Keimzelle, aus der Quartier 4 geboren wurde, zwar unterschiedlichen Ursprungs, aber sehr ähnlicher Zielsetzung.
Welche allgemeinen oder auch konkreten Möglichkeiten sehen und verfolgen Sie, um gemeinsam mit anderen Gruppierungen die Bürgerbeteiligung und Partizipation im Sinne eines guten Gemeinwesens voranzubringen?
Sachse-Domschke: Quartier 4 bietet eine wahrnehmbare Plattform, Räume und Zeit für jeden, sich mit Gleichgesinnten, die ihr Lebensumfeld gestalten wollen, zusammenzutun.
Konkret sieht das so aus, dass ich selbst und alle anderen Quartier 4-Teamer das persönlichen Gespräch mit Menschen vor Ort, bestehenden Institutionen, kommunalpolitischen Entscheidungsträgern, Vereinen etc. suchen. Wir werben für ein gemeinschaftliches Angehen unserer großen Zukunftsthemen zur Erhaltung des Dorfes als lebenswertes Zuhause für alle Generationen und machen Mut für gemeinsame Aktionen.
Über erste Erfolge können wir alle uns bereits freuen:
Seit Anfang des Jahres gibt es zu vier Kernthemen, die wir mit allen Interessierten als zentrale Herausforderungen für unsere Dörfer erkannt haben, Arbeitsgruppen aus jeweils rund 10 Personen, die sich über alle Konfessions-, Partei-, Vereins- und Altersgrenzen hinweg regelmäßig treffen und miteinander konkrete Maßnahmen erarbeiten.
Es ist unglaublich motivierend, das zu sehen, und ich bin überzeugt, dass dies ein gutes und tragfähiges Konzept für Teilhabe und Partizipation ist.
Menschen übernehmen Verantwortung für das Leben vor Ort, ohne darauf zu warten, ob die Politik oder andere Verantwortliche den Startschuss geben.
Das ist eine echte Chance!
Pfarrer Markus Eisele
Pfarrer Eisele: Ich glaube, wir haben in den vergangenen Jahren immer mehr Verantwortung für unser Gemeinwesen delegiert – an den Staat, die Kommune oder soziale Dienste. Damit korrespondiert ein Niveau des selbstbestimmten Lebens, wie es noch vor Generationen undenkbar gewesen wäre.
Jetzt wollen wir wieder umdenken – das ist eine deutschlandweite Bewegung:
Menschen übernehmen Verantwortung für das Leben vor Ort, entwickeln neu eine Sensibilität für ihre Nachbarschaft und werden selbst aktiv – ohne darauf zu warten, ob die Politik oder andere Verantwortliche den Startschuss geben.
Eine echte Chance, vor allem auch für die Generation 60plus. Noch nie zuvor gab es eine dermaßen gut ausgebildete, berufliche erfahrene Generation an Menschen im Ruhestand, die noch etwas tun wollen und es auch können.