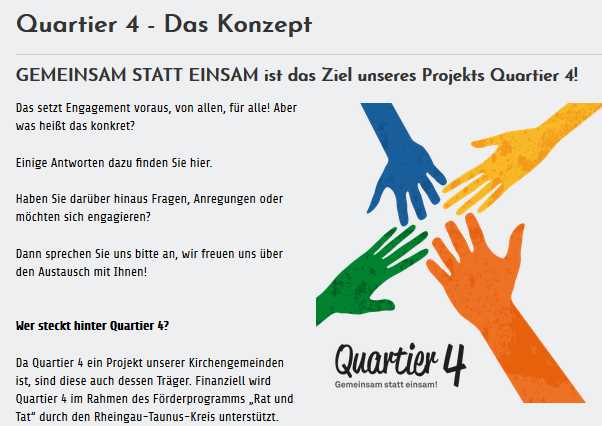Zum 1. Juli 2018 wird die sogenannte HESSENKASSE, das Entschuldungsprogramm für durch Kassenkredite überschuldete hessische Kommunen, an den Start gehen.
In der vergangenen Woche gab es hierzu im hessischen Landtag eine Anhörung, nach deren Ende die Landtagsfraktion der FDP sich öffentlich mit Grundsatzkritik an der HESSENKASSE zu Wort meldete. Die Kritik überrascht nicht als solche, da in der Tat einige Parameter der HESSENKASSE nicht optimal gelöst scheinen. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt aber ebenso wohlfeile wie müßige Kritik der FDP, denn die HESSENKASSE wird in jedem Falle kommen. Und es ist weitgehend klar, in welcher Form.
Ebenso klar ist, dass Kommunen wie Idstein klare Vorteile von ihrer Beteiligung an der HESSENKASSE haben – dafür aber auch einen ziemlich satten Preis zahlen müssen. Während die ULI daher begrüßt, dass sich Idstein am 22. März 2018 für die Teilnahme an der HESSENKASSE ausgesprochen hat, haben wir mit Befremden zur Kenntnis genommen, dass bislang niemand darüber nachzudenken scheint, wie die ca. EUR 590.000 erwirtschaftet werden können, die nach aktueller Prognose mehr als 7,5 Jahre lang jedes Jahr zusätzlich zu allen anderen Haushaltsbelastungen für den gewährten Schuldenschnitt fällig werden.
Wesentlich ist aus Sicht der ULI, dass die Verantwortlichen hier klar- und weitsichtig die Auswirkungen jeder möglichen Maßnahme analysieren – sonst droht ein langfristiger Standortnachteil für Idstein, verursacht durch von kurzfristigen Nöten getriebene Haushaltsplanung.
Vor allem die im HESSENKASSE-Zusammenhang aktuell noch umstrittene Gewerbesteuerumlage benennt eines der zentralen Themen zum Erhalt (oder sogar der Verbesserung) der Qualität Idsteins als Standort für Handel, Wirtschaft und Gewerbe:
Nachdem der Gewerbesteuerhebesatz zuletzt in 2017 angehoben wurde, darf Idstein auf keinen Fall ein weiteres Mal die Gruppe der Gewerbetreibenden unverhältnismäßig stark (über Gewerbesteuer wie Grundsteuer B) belasten, um den kommunalen Haushalt trotz HESSENKASSE-Zahlungsverpflichtungen ausgeglichen zu halten. Dies ließe die Prinzipien von Sozialsolidarität und Gleichbehandlung außer Acht und trüge auf nachgerade gefährliche Art dazu bei, dass Idstein als Wirtschaftsstandort massiv an Attraktivität verlöre. In der Konsequenz wäre mit fehlendem Zuzug und verstärkter Abwanderung von Gewerbebetrieben zu rechnen, was dann nicht erhöhte, sondern verminderte Gewerbesteuereinnahmen generierte. Das wäre der typische Beginn einer Abwärtsspirale des partnerschaftlichen Verhältnisses zwischen einer Kommune und ihren Gewerbetreibenden und ist unbedingt zu vermeiden, um keinen langfristigen Standortschaden für Idstein zu schaffen.