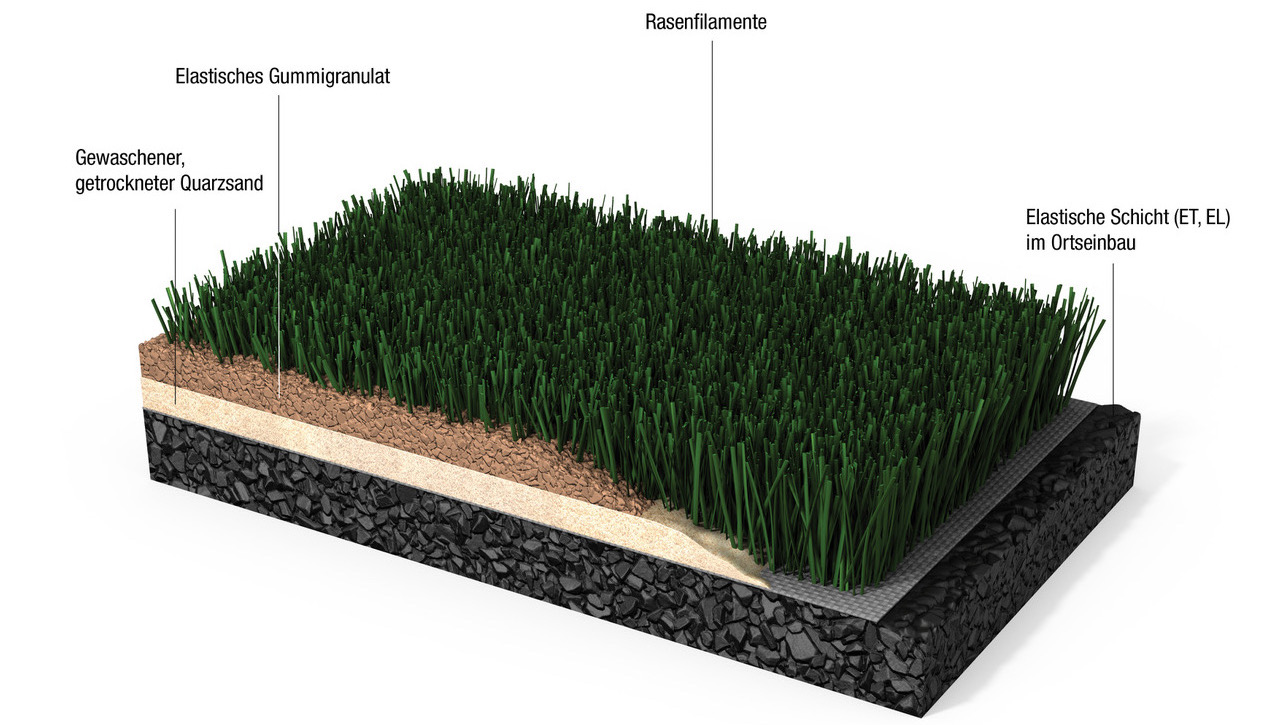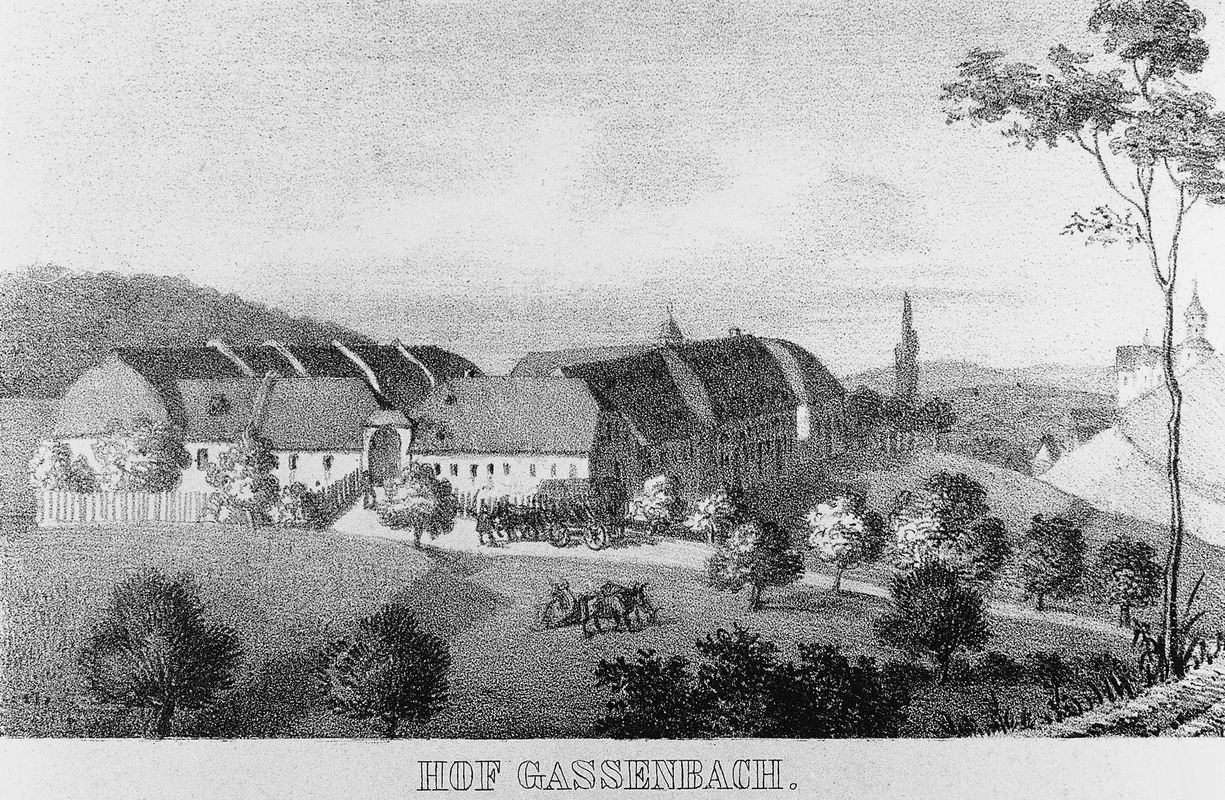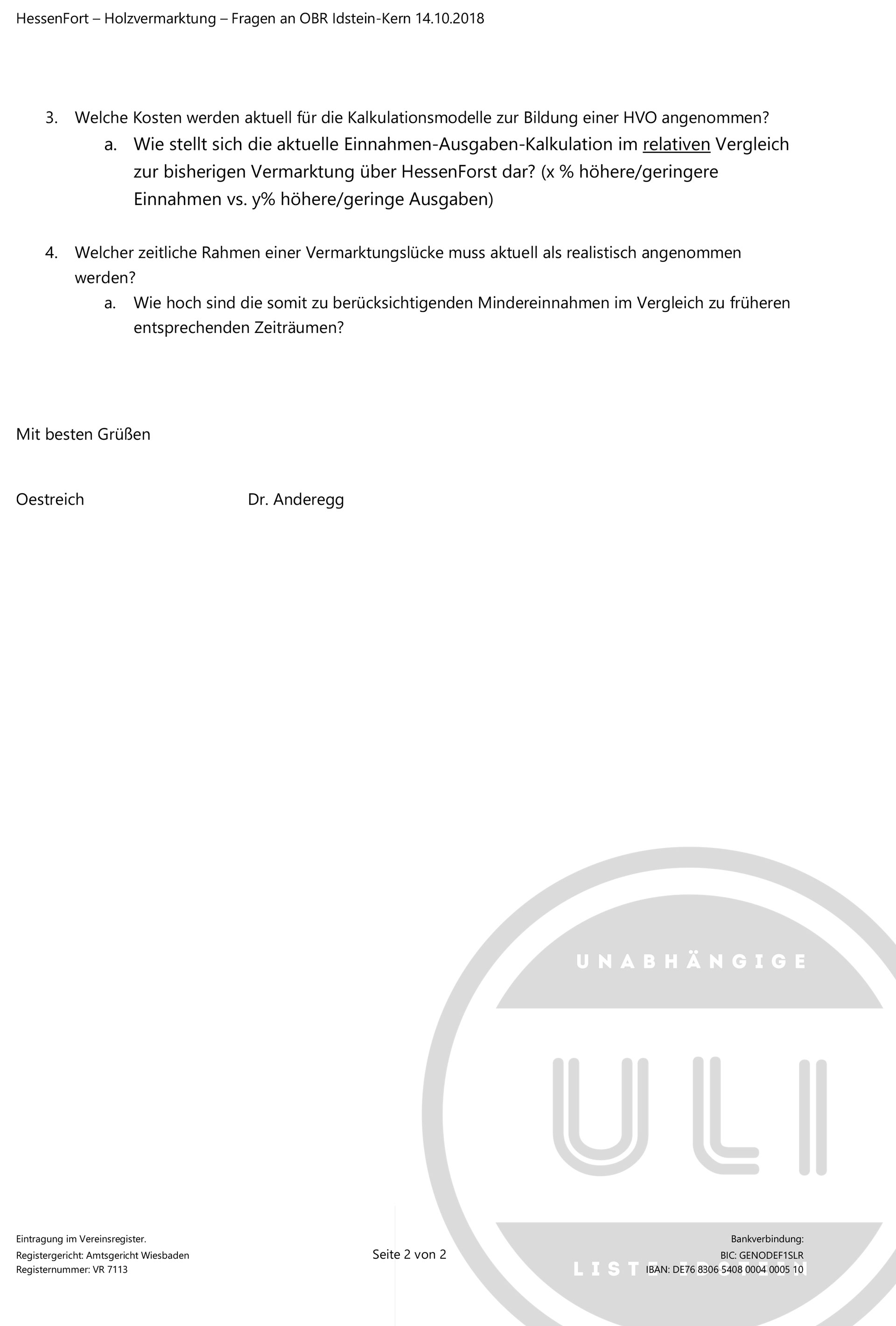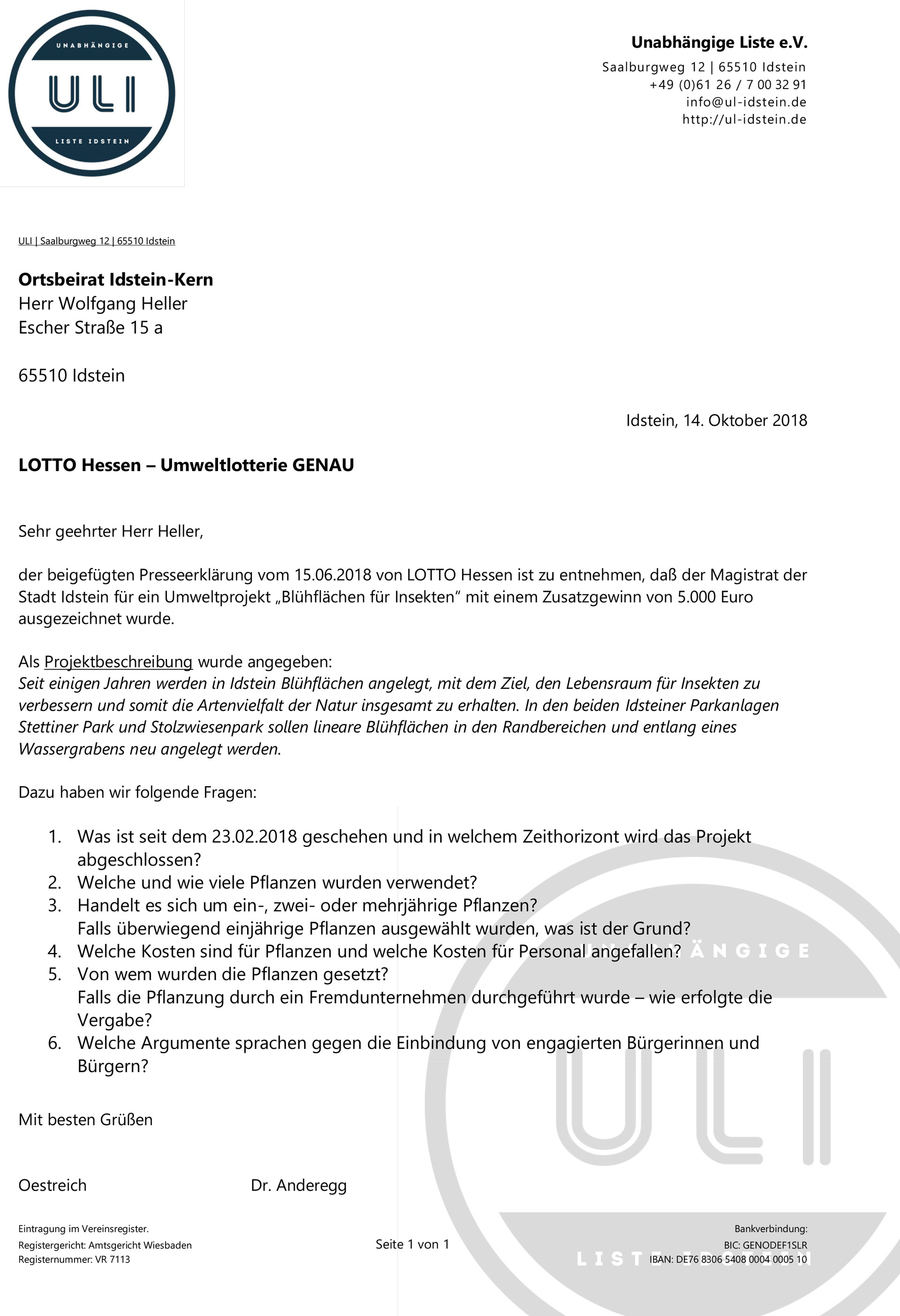Im Jahr 200 nach seiner Gründung wurde, wie es zunächst aussah, das Ende des Hofgutes Gassenbach besiegelt, indem der letzte Pächter, die Wiesbadener Jugendwerkstätten (WJW), fristgerecht zum September 2019 den Pachtvertrag mit dem Eigentümer des Hofgutes, dem Landeswohlfahrtsverband (LWV), aufkündigte.
Der nun auslaufende Pachtvertrag hatte die Pächterin verpflichtet, für Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen selbst aufzukommen. Das war offenbar nicht oder in nicht ausreichendem Maße geschehen, so dass mittlerweile ein Sanierungsstau von geschätzt EUR 4 Millionen aufgelaufen war.
Als landwirtschaftlicher Muster- und Versuchsbetrieb mit angeschlossener Landwirtschaftsschule gegründet, hat der Gassenbacher Hof als Zweigstelle der Domäne Mechthildshausen bis zuletzt nach bioland-Prinzipien ökologisch gewirtschaftet und direktvermarktet, sich um den Erhalt aussterbender Nutztierrassen gekümmert und dabei als Integrationsort für Menschen mit Behinderungen und/oder sozial schwerem Start ins (Berufs-)Leben als Ausbildungs- und Arbeitsplatz eine wichtige gesellschaftliche Funktion übernommen. Noch im Mai letzten Jahres bestanden hier ca. 375 Ausbildungs- und Arbeitsplätze für Menschen, die auf dem 1. Arbeitsmarkt maximal äußerst geringe Chancen haben.
Dass mit all dem nun Schluß sein soll, nur weil die aufgelaufenen Sanierungskosten für die WJW nicht zu stemmen seien, ist der Unabhängigen Liste ein Dorn im Auge. Dass von der Öffentlichen Hand hier kaum unterstützende Aktivitäten zu erwarten seien, wurde im Juni 2018 deutlich, als Bürgermeister Herfurth sich öffentlich dahingehend äußerte, daß die Stadt Idstein „in den nächsten Jahren zunächst Untersuchungen und Konzepte sowie nach einer entsprechenden Freigabe […] mit Stadtumbaumitteln unterstützen“ könne.
„Glaubhaftes Interesse an und entsprechende eigene Initiativen zum Erhalt und einer zukunftsfähigen Neukonzeptionierung des Hofgutes Gassenbach lassen sich in dieser Aussage nicht erkennen“, urteilt die 1. Vorsitzende der Unabhängigen Liste (ULI), Ursula Oestreich. „Spätestens seit der für Idstein in vielerlei Hinsicht und über viele Dekaden signifikant belastenden Entscheidung, für einen weiterhin nicht belastbar bezifferbaren hohen zweistelligen Millionenbetrag das Tournesol zu übernehmen, dürfte klar sein, dass Idsteins Politik und Verwaltung offenbar vor haben, dem Sterben des Gassenbacher Hofes achselzuckend zuzusehen.“
Dem wolle und könne sich die ULI nicht anschließen, die die letzten Monate dazu genutzt habe, ein neues Konzept „Gassenbacher Hof 2.0“ zu konzipieren, das das Potential haben soll, die historische Bedeutung des Gassenbacher Hofs in unsere moderne Lebenswelt zu übertragen und deren Anforderungen auch auf lange Sicht gerecht zu werden. Die tragenden Säulen des Konzeptes sind dabei neben der Landwirtschaft, die weiterhin ökologisch und direktvermarktend ausgerichtet sein wird, die Säulen „Handel & Gewerbe“ sowie „Land-Gastwirtschaft und –Gastronomie“. Die detaillierte Ausgestaltung der einzelnen Säulen mit zum Teil bereits konkret identifizierten Interessierten aus lokalem Handel, Handwerk und Restauration ist ein integrativ-systemisches Ganzes, in dem auch der Aspekt „Aus- und Weiterbildung“ seinen Platz findet – modern und zukunftsgerichtet interpretiert. Auch wenn die Hochschule Fresenius sich, trotz Interesse an dem Konzept, aufgrund andersgearteter eigener Standortstrategie gegen eine Teilnahme an der Konzeptumsetzung ausgesprochen hat, wären andere mögliche gemeinnützige Partner wie der Internationale Bund durch die ULI bereits in Konzeptgespräche einbezogen worden, die ausreichende Finanz- und Handlungskraft besäßen, um zusammen mit kleineren Partnern wie Vertretern von traditionellen Handwerken das Gesamtkonzept umzusetzen.
Der ULI ist es dabei wichtig, dass auf der einen Seite zwar ausreichende Wirtschaftskraft hinter dem „Gassenbacher Hof 2.0“ stünde, um ihn auch erfolgreich etablieren und führen zu können, er andererseits aber in einer Gesellschaftsform geführt würde, die keinem einzelnen der Beteiligten Entscheidungsmacht und –befugnisse gäbe, die die Ziele der kleineren Partner erdrücken und ihnen kein ausreichendes Mitentscheidungsrecht überlassen würde.
Mitglied im „Gesunden Städtenetzwerk“ zu sein, bewirke zunächst faktisch nichts weiter und bleibe damit ein leeres Versprechen, meint Oestreich; ähnlich sei es bei Gütesiegeln wie „FairTrade Town Idstein“: „Das Konzept ‚Gassenbacher Hof 2.0‘ dagegen ist eine einmalige Chance für die Stadt Idstein, sich mit einem Vorzeigeprojekt im Nachhaltigkeitsdreieck von Ökonomie, Ökologie und Sozialem frisch und modern aufzustellen und gleichzeitig einen aktiven Beitrag zur Gewerbeförderung und zum Stadtmarketing, zur gesunden Ernährung der Bevölkerung und zum Erhalt von Frei- und Grünräumen und damit zur Lebensqualität in Idstein beizutragen.“